|
.
Kurzinfo:
Ein Architekt plant eine neue Grundschule und stellt auch die erforderlichen
Nachweise gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) aus. Die gedämmte
Bodenplatte des Neubaus liegt vollflächig auf dem Erdreich. Die EnEV 2009 regelt
in Anlage 2 (Anforderungen für Nichtwohngebäude) auch die maximalen U-Werte für
opake Außenbauteile und wie man die die einzelnen Außenbauteile rechnerisch
berücksichtigt. Verglichen mit den U-Wert-Anforderungen der EnEV 2009, Anlage 3
(Anforderungen im Baubestand) stellt der Architekt fest, dass es theoretisch
möglich wäre in dem Neubau eines Nichtwohngebäudes eine Bodenplatte einzuplanen,
die einen geringeren Wärmeschutz aufweist, als die EnEV 2009 bei der Sanierung
derselbigen fordern würde. Der Fachmann bittet uns um die Meinung eines
EnEV-Experten zu diesem Widerspruch.
|Aspekte
|Auftrag
|Praxis
|Probleme
|Fragen
|Antwort
Aspekte:
EnEV, 2009, Energieeinsparverordnung, Nichtwohnbau,
Nichtwohngebäude, Schule, Schulbau, Grundschule, Schulgebäude,
Gebäude, Neubau, neu, zu, errichten, bauen, planen, entwerfen,
Bodenplatte, gedämmt, dämmen, Dämmung, Wärmedämmung,
Anforderung, Wärmeschutz, Anlage, 2, Wärmedurchgangskoeffizient,
U-Wert, Höchstwert, Höchstwerte, maximal, Sanierung, sanieren,
Modernisierung, modernisieren, Erneuerung, erneuern, Ersatz,
ersetzen, DIN, 4108, Energieeinsparung, Teil, 2, Mindestwert,
Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedurchlasswiderstände, Widerspruch
Auftrag: Ein
Architekt plant eine neue Grundschule und stellt auch die EnEV-Nachweise aus.
Praxis: Die gedämmte
Bodenplatte des Neubaus liegt vollflächig auf dem Erdreich. Die EnEV 2009
erlaubt gemäß Anlage 2 (Nichtwohngebäude) für opake Außenbauteile einen
Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von höchstens 0,35 Watt pro Quadratmeter
und Kelvin (W/m²K). Unter Nr. 2.3 (Berechnung des Mittelwerts des
Wärmedurchgangskoeffizienten) regelt die Verordnung, dass Bauteile, die an
Erdreich grenzen, zusätzlich mit Faktor 0,5 zu gewichten sind.
Probleme: Dies führt
aus der Sicht des Architekten jedoch dazu, dass die Bodenplatte auf Erdreich
einen maximalen U-Wert von 0,70 W/m²K haben kann oder noch schlechter, wenn die
anderen Außenbauteile niedrigere U-Werte als 0,35 W/m²K aufweisen.
Bei Sanierung bzw. eines erstmaligen Einbaus einer Bodenplatte auf Erdreich
erlaubt die EnEV 2009 in Anlage 3 (Anforderungen Baubestand), Tabelle 1
(Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Bauteile) einen U-Wert von
höchstens 0,30 W/m²K.
Daraus ergibt sich aus der Sicht des Architekten ein großer Widerspruch, denn
das hieße, dass ein Neubau einen schlechteren U-Wert der Bodenplatte haben
könnte als bei einer Sanierung / Erneuerung erlaubt wäre.
Bei einem U-Wert von 0,70 W/m²K wird der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108
(Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden), Teil 2 (Mindestanforderungen an
den Wärmeschutz), Tabelle 3 (Mindestwerte für Wärmedurchlasswiderstände von
Bauteilen) eingehalten, also ist diese Anforderung an den Neubau eindeutig
erfüllt; bei der Erfüllung der EnEV hat der Architekt allerdings Zweifel.
Frage: Wie erklärt
sich diese Diskrepanz der Anforderungen der EnEV 2009 für den Wärmeschutz der
Bauplatte bei Neubau und bei Sanierung?
Antwort:
11.09.2011 - wenn Sie unseren Premium Zugang abonniert haben, lesen Sie die folgende passwortgeschützte Antwort:
 Bodenplatte
für neue Grundschule planen Bodenplatte
für neue Grundschule planen
Leseprobe Nichtwohnbau: Fragen
+ Antworten
Wollen Sie unseren Premium-Zugang kennenlernen?
Über 500 Antworten auf EnEV-Praxisfragen finden Sie
als Abonnent in unserem Premium-Bereich. Per E-Mail erfahren Sie über neue Antworten und Downloads.
 Premium Zugang: Jetzt informieren und bestellen
Premium Zugang: Jetzt informieren und bestellen

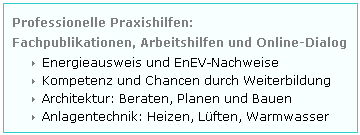
|
|