|
Leitsatz: Die nach der EnEV 2009 für die
Bestimmung von Wärmedurchgangskoeffizienten angegebenen technischen Regeln
enthalten keine Angaben zur Vorgehensweise bei erdberührten Teilflächen der
Gebäudehülle. DIN V 4108-6: 2003-06 Anhang E definiert für Zwecke der
energetischen Bilanzierung von Wohngebäuden für diese Flächen einen
„konstruktiven U-Wert“. Diese Größe beschreibt das in Anlage 3 Tabelle 1 Zeile 5
a und b EnEV 2009 sowie in Anlage 2 Nr. 2.3 Satz 2 und 3 EnEV 2009 Gewollte.
Drei Fragen:
-
Wie
sind die Wärmedurchgangskoeffizienten von erdberührten Bauteilen
und von Wänden und Decken gegen unbeheizte Kellerräume zu
bestimmen, für die nach Anlage 3 Tabelle 1 Zeile 5 a und b EnEV
2009 Grenzwerte einzuhalten sind?
-
Wie
sind die entsprechenden Angaben für die Ausführung des
Referenzgebäudes in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1
EnEV 2009 definiert?
-
Wie
ist bei der Berechnung dieser Wärmedurchgangskoeffizienten nach
Anlage 2 Nr. 2.3 EnEV 2009 vorzugehen?
Antwort der Projektgruppe EnEV der Fachkommission "Bautechnik" der
Bauministerkonferenz veröffentlich am 27. Juni 2011:
-
Der Wärmedurchgangskoeffizient ist
eine zentrale Größe zur Beschreibung der energetischen Qualität
von Außenbauteilen im Rahmen der EnEV. Bei der Berechnung des
Jahres-Primärenergiebedarfs nach den Anlagen 1 und 2 sowie des
Transmissionswärmeverlusts nach Anlage 1 wird der
Wärmedurchgangskoeffizient durch Folgeverweisungen in den zu
beachtenden technische Regeln definiert. Für opake Bauteile,
soweit sie nicht gegen Erdreich oder Kellerräume abgrenzen,
wird dort regelmäßig auf DIN EN ISO 6946: 1996-11 verwiesen.
-
Soweit die EnEV direkt auf
Wärmedurchgangskoeffizienten Bezug nimmt, ist die Definition in
Anlage 3 Nr. 7 (Fußnote 1 zur Tabelle 1) maßgebend, die insoweit
mit der für die Berechnungen anzuwendenden Definition identisch
ist. Dort heißt es zur Definition der Höchstwerte in den Spalten
3 und 4:
„Wärmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Berücksichtigung
der neuen und der vorhandenen Bauteilschichten; für die
Berechnung opaker Bauteile ist DIN EN ISO 6946:1996-11 zu
verwenden“
-
DIN EN ISO 6946:1996-11 gilt
jedoch nicht für an das Erdreich grenzende Bauteile
(einschließlich Decken und Wände zu unbeheizten Kellerräumen)
und enthält folglich keine belastbaren Angaben zur Berechnung
von Wärmedurchgangskoeffizient solcher Bauteile. Die nach Anlage
1 und 2 EnEV 2009 anzuwendenden energetischen
Bilanzierungsverfahren nach DIN V 18599-2 und DIN V 4108-6
basieren hinsichtlich dieser Bauteile grundsätzlich auf DIN EN
ISO 13370:1998-12, die aufgrund ihres ganzheitlichen und
monatsweise differenzierten Ansatzes keinen
Wärmedurchgangskoeffizienten – insbesondere nicht für
Teilflächen – definiert.
-
Leitsatz: DIN V 4108-6:2003-06
enthält daneben auch ein vereinfachtes Verfahren für die
Bilanzierung von erdberührten Flächen, für welches in Anhang E
dieser Norm ergänzend zu
DIN EN ISO 6946 und DIN EN ISO 13370 ein sogenannter
„konstruktiver U-Wert“ definiert ist.
-
Die in Deutschland allgemein
übliche Vorgehensweise bei der Bestimmung von
Wärmedurchgangskoeffizienten. Zumal ein
Wärmedurchgangskoeffizient für erdberührte Bauteilflächen
im übrigen anzuwendenden Regelwerk nicht definiert ist, sind
alle diesbezüglichen Angaben in der EnEV 2009 auf der Grundlage
dieser Definition zu verstehen.
-
In Anlage 2 Nr. 2.3 EnEV 2009 sind
für die „Berechnung des Mittelwerts des
Wärmedurchgangskoeffizienten“ opaker Bauteile detaillierte
Berechnungsregeln enthalten. Danach sind die
Wärmedurchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen unbeheizte
Räume und Erdreich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten. Ferner
dürfen bei an das Erdreich grenzenden Bodenplatten Flächen
unberücksichtigt bleiben, die mehr als 5 m vom äußeren Rand des
Gebäudes entfernt sind. Diese Regelungen schließen es aus,
anstelle des „konstruktiver U-Werts“ einen nach DIN EN ISO 13370
bestimmten fiktiven U-Wert auf Grundlage des nach dieser Norm
berechneten Transmissionswärmeverlusts zu
verwenden, weil dieser Wert bereits eine Gewichtung enthält und
deshalb kein Wärmedurchgangskoeffizient im Sinne der Vorschrift
ist.
-
Anlage 2 Nr. 2.3 Satz 3 EnEV 2009
ist eine „Kann-Bestimmung“ und lässt es deshalb auch zu,
Teilflächen der erdberührten Bodenplatte bei der
Mittelwertbildung zu berücksichtigen, die mehr als 5 m vom
äußeren Rand des Gebäudes entfernt sind. Dies kann insbesondere
dann vorteilhaft sein, wenn diese Flächen gut gedämmt sind.

 Fragen + Antworten zur EnEV 2009 nach Themen
finden
Fragen + Antworten zur EnEV 2009 nach Themen
finden

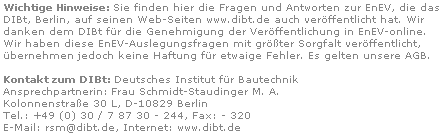

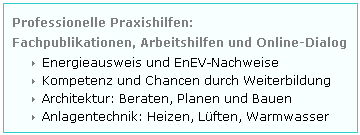

|
|