|
Frage: Unter welchen Voraussetzungen darf
Strom aus erneuerbaren Energien bei Berechnungen nach der EnEV 2009
berücksichtigt werden? Wie ist dabei vorzugehen?
Antwort der Projektgruppe EnEV der Fachkommission "Bautechnik" der
Bauministerkonferenz vom 9. Dezember 2009, veröffentlicht am 17. Dezember 2009:
-
Auf
Grund von § 5 EnEV darf bei zu errichtenden Gebäuden bei den
Berechnungen nach § 3 Absatz 3 EnEV und § 4 Absatz 3 EnEV Strom
aus erneuerbaren Energien berücksichtigt werden, indem die
derart erzeugte Strommenge vom Endenergiebedarf
abgezogen wird; auf Grund von § 9 Absatz 2 Satz 1 i. V. m. § 5
EnEV ist diese Vorschrift auch bei Berechnungen im Rahmen von
wesentlichen Änderungen bestehender Gebäude anwendbar.
-
Voraussetzungen für die Anrechnung sind, dass der Strom in
unmittelbarem räumlichem Zusammenhang zu dem Gebäude erzeugt und
vorrangig in dem Gebäude selbst genutzt und nur die
überschüssige Energiemenge in ein öffentliches Netz eingespeist
wird. Ferner darf nach § 5 Satz 2 EnEV höchstens diejenige
Strommenge angerechnet werden, die dem berechneten Strombedarf
der jeweiligen Nutzung entspricht.
-
Von
einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu dem Gebäude ist
dann auszugehen, wenn zur Nutzung des Stroms aus erneuerbaren
Energien im Gebäude dieser Strom nicht über Leitungen eines
öffentlichen Verteilungsnetzes geführt wird. Es
ist dagegen unerheblich, ob die Gebäudeeigentümer selbst
Betreiber der Erzeugungsanlage sind oder ein Dritter. Auch
können unter der vorgenannten Voraussetzung (keine Übertragung
über öffentliche Netze) sogenannte „Quartierslösungen“, also für
mehrere Gebäude eingerichtete gemeinsame Erzeugungsanlagen,
berücksichtigt werden.
-
Strom
aus Photovoltaikanlagen stellt in der Praxis den wesentlichen
Anwendungsfall für § 5 EnEV dar. § 5 EnEV trägt insbesondere der
Änderung der Fördervoraussetzungen nach § 33 Absatz 2 des
Gesetzes über den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) Rechnung.
Da bei Anwendung der Regelung des § 33 Absatz 2 EEG ein Nachweis
über die verwendete Strommenge zu führen ist, ist davon
auszugehen, dass neben den vertraglichen auch die schaltungs-
und messtechnischen
Voraussetzungen geschaffen werden. Somit kann bei
Photovoltaikanlagen im Einzelfall eindeutig zwischen „vorrangig
selbst genutztem“ und „in das öffentliche Netz eingespeistem“
Strom unterschieden werden; der Vorrang für die Selbstnutzung
bis zur Höhe des benötigten Stroms wird schon durch die
Schaffung der Voraussetzungen für die Nutzung der Option des §
33 Absatz 2 EEG dokumentiert.
-
Die
Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach der
Energieeinsparverordnung erfolgt in beiden anwendbaren
Berechnungsverfahren (DIN V 18599 und DIN V 4108-6
i. V. m. DIN V 4701-10) auf der Basis einer Monatsbilanz. Der
Abzug von in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang erzeugtem
Strom aus erneuerbaren Energien muss in konsequenter Fortführung
dieses Grundsatzes ebenfalls
monatsweise erfolgen. Die höchstmögliche anrechenbare Strommenge
ergibt sich daher bei der Berechnung somit monatsweise als
„Endenergiebedarf Strom“.
-
Der
Energieertrag der Photovoltaikanlage ist mit geeigneten
technischen Regeln monatsweise zu berechnen. Hierfür bietet sich
die im Lichte der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden (2002/91/EG) erstellte DIN EN 15316-4-6:
2009-07 an, die unter Verwendung der in Deutschland monatsweise
vorliegenden Einstrahlungskennwerte (DIN V 4108-6 oder DIN V
18599-10) auch zur monatsweisen Ermittlung des Ertrages von
Photovoltaikanlagen angewendet werden kann.

 Fragen+Antworten zur EnEV 2009 nach Themen finden
Fragen+Antworten zur EnEV 2009 nach Themen finden

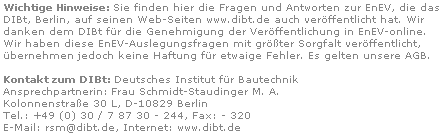

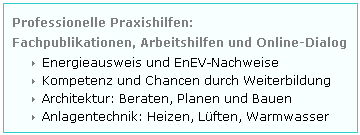

|
|